Top-Fragen
Zeitleiste
Chat
Kontext
Liste der Kinos im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf
Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Remove ads
Remove ads
Die Liste der Kinos im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf gibt eine Übersicht aller Kinos, die im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf existiert haben oder noch existieren. In der Liste sind die Ortsteile entsprechend der Grenzen seit der Bezirksreform 2001 enthalten und alphabetisch vorsortiert: Dahlem, Lankwitz, Lichterfelde, Nikolassee, Schlachtensee, Steglitz, Wannsee, Zehlendorf. Die Liste wurde nach Angaben aus den Recherchen im Kino-Wiki[1] aufgebaut[2] und mit Zusammenhängen der Berliner Kinogeschichte aus weiteren historischen und aktuellen Bezügen verknüpft. Sie spiegelt den Stand der in Berlin jemals vorhanden gewesenen Filmvorführeinrichtungen als auch die Situation im Januar 2020 wider. Danach gibt es in Berlin 92 Spielstätten, was Platz eins in Deutschland bedeutet, gefolgt von München (38), Hamburg (28), Dresden (18) sowie Köln und Stuttgart (je 17).[3] Gleichzeitig ist diese Zusammenstellung ein Teil der Listen aller Berliner Kinos und der Ortsteillisten.
Remove ads
Einleitung
Zusammenfassung
Kontext
„Beim Vogelschießen in Steglitz spielten [im August 1903] die Kinematographen von Wilhelm Hartkopf, der auch ein nicht näher bezeichnetes ‚Museum‘ zeigte, sowie [der Kinematograph] eines Herrn Salzmann. Ferner gab es eine amerikanische und russische Schaukel, Karussells, Athleten und Riesenmädchen, Schießbuden, Photographen sowie eine ganze Anzahl von Spiel- und Verkaufsbuden. Geschäft und Wetter sehr schlecht.“ ([4]): Auf dem Schützenfest in Steglitz war im Mai 1910 neben einem Bären-Theater, einem Hunde-Theater und einen Spezialitäten-Theater auch ein von dem Schausteller Karl Birkeneder betriebener Kinematograph vertreten.[5]
Die ersten nachweisbaren Kinos in Steglitz entstanden ab 1907. Es waren kleinere, wenig repräsentative Räume wie anderswo in Restaurationen oder als Laden-Kino eingerichtet. Sie eröffneten in Straßen mit starkem Publikumsverkehr, so in der schon damals zentralen Schlossstraße. Bis zum Bau des Großkinos Titania-Palast siedelten sich zwischen 1907 und 1910 das „Metropol-Lichtbildtheater“, das „Flora-Kino“ und das „Palast-Theater“ an, am Steglitzer Stadtpark folgten 1911 „Das Deutsche Theater“ und „P.T. Lichtspiele“. Groß-Lichterfelde war wohl für Kinematographentheater 1909 mit der Gründung des Central-Kinos am Hindenburgdamm geeigneter als Zehlendorf, wo erstmals Lichtspiele 1918 folgten.
Der Kinospielplan war aktuell,[6] so dass der Steglitzer nicht „den zeitraubenden Weg nach Berlin antreten muß, wenn man die neuesten und beliebtesten Darbietungen der gegenwärtigen Filmkunst genießen will!“ ([7]) Gezeigt wurden filmtechnischen Sensationen: Mitte September 1924 zeigten „die Albrechtshof-Lichtspiele im Vorprogramm einen amerikanischen Western als plastischen Film ‚Plastigram – Der Film der dritten Dimension‘. Gratis verteilte Brillen [verschafften den Zuschauern den Eindruck], als handle es sich auf der Leinwand nicht mehr um ‚Bilder‘, sondern als träten Persönlichkeiten und Gegenstände in voller, plastischer Lebenserscheinung hervor.“ ([8]) Für die Stummfilme gab es neben musikalischer Untermalung auch Filmvorträge. Anfang Dezember 1927 hatten die Albrechtshof-Lichtspiele für eine Sonntags-Matinee um 11 Uhr den programmfüllenden Kulturfilm „Das schaffende Amerika“ eingesetzt, den der Vortragsredner Kapitän Gottfried Speckmann kommentierte.[9] Am 19. Oktober 1929 war der Sexualforscher Magnus Hirschfeld in Steglitz, wo er in Nachtvorstellungen im Globus-Palast und den Bismarck-Lichtspielen Vorträge über die sexuelle Frage hielt und zu dem bereits von 1922 stammenden österreichischen Kulturfilm Hygiene der Ehe sprach.[10]

Wie anderswo gab es Kino-Brände: Am 14. November 1927 entzündete sich im Vorführraum des Lichtspielhauses Südende ein Film. „Der Löschzug Steglitz kämpfte den Brand mit einem C-Rohr nieder und konnte nach etwa 1½-stündiger Tätigkeit abrücken. Eine Panik unter den Besuchern entstand nicht.“ ([11])
In den 1920er Jahren war im Südwesten ein wichtiger Standort für die Filmindustrie. Die „Deutsche Mutoskop- und Biograph GmbH“ in (Groß-)Lichterfelde (Tochtergesellschaft der American Mutoscope and Biograph Company) errichtete 1904 das älteste deutsche Filmatelier in der Zietenstraße 10 das ausschließlich für die Aufnahme und Produktion von Filmen dienende große Glasatelier. Während des Bestand wurden rund 500 Filme geschaffenen. Anfang der 1910er Jahre richtete sich Heinrich Bolten-Baeckers ein Atelier ein. Filmgrößen wie Hilde Hildebrand, Paul Heidemann und Konrad Dreher erlebten ihr Filmdebüt. Ernst Lubitsch drehte auf dem Freigelände „Rauhe Berge“ den Monumentalfilm Das Weib des Pharao. So wurde Steglitz als das „deutsche Hollywood“ gewürdigt. 1920 entstand ein Film über das „Haus der Kinder“, den ersten Volkskindergarten nach der Montessori-Methode. 1928 wurde der Bau des „Titania-Palastes“ im Film dokumentiert, der zur Eröffnung des Kinos gezeigt wurde.[12]
„Internationale Filmfestspiele in Lankwitz, geht so etwas überhaupt? Ein bisschen vom großen Glamour verteilt Berlinale-Chef Dieter Kosslick seit 2010 auf die weniger atemberaubenden Ecken der Stadt. In Lankwitz ist das 1953 gebaute Thalia an der Kaiser-Wilhelm-Straße 71 dabei.“ ([13])
Im Bezirk bestanden über die Jahre 45 Kinos. Von 29 Vorkriegskinos mussten neun wegen Kriegsschäden schließen. 15 Bezirkskinos mit 500 bis 700 Plätzen wurden in den Nachkriegsjahren eröffnet, davon sieben Ende der 1940er und weitere bis 1957. Aktuell gibt es noch (Stand: 2016) fünf Kinos in Steglitz-Zehlendorf: das „Thalia Movie Magic“ in Lankwitz ist das älteste im Bezirk bestehende Kino, in Steglitz befinden sich das „Adria Filmtheater“ und das „Cineplex Titania“, in Dahlem das „Capitol“ und das „BaLi“ in Zehlendorf.
In der folgenden Liste sind die Kinos alphabetisch nach Ortsteilen und innerhalb dieser nach dem letzten oder bestehenden Kinonamen vorsortiert. Das Berliner Adressbuch nennt im Gewerbeteil der Vororte für das letzte Jahr vor der Bildung von Groß-Berlin Paul Eitner für Berlin-Lichterfelde,[14] in Berlin-Steglitz sind Harry Fabian (mit dem Kinotheater Thorwaldsenstraße 25), Christian Fonfara (Schildhornstraße 76 I. Stock), Kino-Betriebs-Gesellschaft Rothenbücher & Fehr (Florastraße 19), Hugo Lemke („Lichtspiele“, Albrechtstraße 132), „Lichtbildtheater Albrechtshof“ (Albrechtstraße 1a), „Palast-Theater Eugen Pleßner“ (Schloßstraße 92), A. Schubert (Kinobesitzer Potsdamer Straße 22 2. Aufgang) und Robert Wiesner (Kinobesitzer Körnerstraße 39 II.Stock) aufgenommen.[15] Für Berlin-Dahlem, Berlin-Lankwitz, Nikolassee und Zehlendorf mit Schlachtensee sind keine Personen im Kinogewerbe aufgenommen.
Remove ads
Kinoliste
Zusammenfassung
Kontext
Weitere Informationen Ortsteil, Name/Lage ...
| Ortsteil[16] | Name/Lage | Adresse | Bestand | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Dahlem | Capitol
(Lage) |
Thielallee 36 | seit 1946 |  „Schaukästen säumen den Gehweg, der durch einen kleinen Vorgarten zu dem zweigeschossigen und leicht zurückgesetzten Gebäude führt. Oberhalb der bogenförmigen Eingangstüren hängt eine große Reklametafel, die als Einziges einen Hinweis auf das Kino gibt. Direkt hinter dem Eingang befindet sich im ersten Foyerbereich die Kasse und ein Verkaufsstand. […] Wie früher üblich wird der Kaffee in Tassen und der Wein in Gläsern serviert.“ ([22]) Das Capitol ist ein Programmkino der ersten Stunde mit anspruchsvollen Filmen. Der langjährige Leiter Gerhard Klein bot das „Literarische Podium“ an mit Lesungen und Vorträgen von bekannten Schauspielern wie Curt Bois oder Martin Held und die Eddie-Constantine-Nächte. Der Projektorraum ist in einem nur von außen zugänglichen Anbau untergebracht. Der Zuschauersaal mit drei Vierteln mintgrüner Kinositze mit Flaschenhaltern im Parkett-Bereich ist in die Länge gezogen mit einer hohen Decke. Vor der Leinwand gibt es eine kleine Holzbühne, vor der Leinwand hängt ein silberner Wolkenvorhang. |
| Dahlem | Outpost
(Lage) |
Clayallee 135 | 1953–1994 |  |
| Lankwitz | Capitol
(Lage) |
Kaiser-Wilhelm-Straße 88 | 1933–1943 |  1943 wurde das Kinogebäude durch Bomben zerstört, der Betrieb endete. Der hintere Kinosaal ist im Gegensatz zur Bebauung an der Straßenfront nicht wieder aufgebaut worden.[26] In den 1970er Jahren erfolgte eine neue Bebauung mit fünfgeschossigen Appartementhäusern. Diese bilden eine Straßenfront 82–88 (gerade) mit einer Querbebauung auf 88, sodass Grundstück 90 als Grünfläche nutzbar wurde. |
| Lankwitz | Lichtburg ---- Viktoria-Lichtspiele (Lage) |
Leonorenstraße 51 | 1927–1971 | Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. Den Krieg überstand das Kino relativ unbeschadet und konnte so den Kinobetrieb schon 1946 wieder aufnehmen. Zunächst ist Georg Fiebiger Kinobesitzer mit 450 Plätzen und einer Theaterlizenz für die Bühne von 5,2 × 2,4 m² mit Varieté-Kabine. 1950 führt Karl Heinz Bukofzer die Lichtburg von Erich Bukofzer und Erich Loschinski. Ab 1952 ist Frau Margarete Gierig als Inhaberin genannt. Die 15 Wochen-Vorstellungen werden auf sieben Tage gegeben, Film-Projektion erfolgt (Lichtquelle: Reinkohle) von zwei (rechts und links) Ernemann IV, für den Ton der 40-Watt-AEG-Verstärker und es gibt Dia-Projektion mit Ton. Mit der Einführung von Breitwand entfällt die Bühne 1956, es ist CinemaScope mit Einkanal-Lichtton auf die Bildwand als 3 × 4, 3 × 5,5 oder 3 × 7 Meter möglich. Für die Zuschauer stehen bei den täglich zwei Vorstellungen und wöchentlich einer Spät- und einer Jugendvorstellung 435 Hochpolstersessel bereit. Das Kino wurde am 1. November 1971 geschlossen. Bereits kurz danach wird das Gebäude für immer abgerissen und 1973 befindet sich der viergeschossige an das Stadtbad Lankwitz grenzende Neubau auf dem Plan. |
| Lankwitz | Lichtspiele in der Gemeindehalle
(Lage) |
Dillgesstraße 27 | 1919–1923 |  |
| Lankwitz | Mühlen-Lichtspiele ---- Gloria Auen-Filmschau (Lage) |
Mühlenstraße 21 | 1924–1943 | Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. |
| Lankwitz | Thalia[34]
(Lage) |
Kaiser-Wilhelm-Straße 71 | seit 1953 |  Nach einer langjährigen wirtschaftlich schwierigen Situation stand das Kino 1979 vor der Schließung und Umbau zum Supermarkt. Eine Bürgerinitiative erreichte die Rücknahme der selbst eingereichten Kündigung. Der damalige Kinobetreiber Peter Vollmann entschloss sich zum Umbau des 280-Plätze-Saals zu einem Kinocenter mit vier Sälen. Die Säle 3 und 4 entstanden aus dem großen Saal 1. Das Foyer wurde auf dem Weg zur Kasse als Mini-Supermarkt errichtet. Diese Anordnung wurde vom jetzigen Kinobetreiber Peter Wagner (auch Casablanca), der das Kino 1998 übernahm, aufgelöst. Die verglaste Wand innerhalb des Foyers kennzeichnet noch immer den Standpunkt der ehemaligen Einkaufsmöglichkeit, wird heute aber ausschließlich als Kinokasse und zum Snack-Verkauf genutzt.[39] „Das Thalia Kino ist in der Nähe von Lankwitz-Kirche. […] Schon in den 1960er und 1970er Jahren gingen die Leute dort ins Kino. Es gibt vier Kino-Säle, es gibt Filme für Kinder und Erwachsene. Es gibt zwei Toiletten für Mädchen. Mit Freundinnen und Freunden kann man sich vor dem Kino treffen, da kann man Fahrräder anschließen. Im Kino kann man jede Menge Snacks und Getränke kaufen.“ ([40])
|
| Lichterfelde | Central-Lichtspiele
(Lage) |
Hindenburgdamm 93a | 1909–1935 | Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. |
| Lichterfelde | Der Spiegel
(Lage) |
Drakestraße 50 | 1952–1973 |   „In Berlin-Lichterfelde-West, Drakestraße 50, eröffnete Kurt Rilk, Inhaber der Zehlendorfer Filmtheater ‚Zeli‘ und ‚Rathaus‘, ein nach modernsten, künstlerischen und technischen Gesichtspunkten ausgestattetes Lichtspielhaus mit dem seltenen Namen ‚Der Spiegel‘. Das Haus — es ist das 204. Filmtheater West-Berlins — faßt 625 Plätze. Voelker und Grosse, die bekannten Erbauer des Berliner Schiller-Theaters, waren die Architekten. Vom September 1951 an wurde — auch den ganzen Winter über — gebaut. An besonderer Ausstattung fallen auf: die rotgepolsterten Wände des mit Vitrinen versehenen Foyers (zwei Kassen) und die Leistenwände im Zuschauerraum (10.000 Meter Leisten wurden verwendet); sie garantieren eine hervorragende Akustik. Technische Ausrüstung (durch Ufa-Handel): zwei Ernemann-X-Projektoren [Verstärker Klangfilm-Klarton] und eine Schwerhörigenanlage. Das Haus fand schon in den ersten Tagen seines Bestehens vor allem durch die Lichterfelder Bevölkerung regen Zuspruch.“ ([47]) Der Glaserker in der Mitte und der ausladend überdachte Eingangsbereich mit den schräg gestellten Stützen, die das Vordach tragen sind in ihrer schlichten Schönheit kraftvolle Elemente der Architektur der Wirtschaftswunderzeit. Ältere Lichterfelder erinnern sich daran, hier alle Filme mit Maria Schell gesehen zu haben.[48] „Modern, mit einer nicht alltäglichen Linienführung, […] ergibt die leichte Neigung der Längswände und der seitlichen Stuckeinfassung das Bühnenportal. Eine Holzleistenverkleidung tragen die Wände und die Rangbrüstung des 600-Platz-Theaters. Projiziert wird aus 24 m Entfernung auf eine Bildwand von etwa 3,75 X 5,0 Metern.“ ([49]) Das Filmtheater besaß eine Bühne mit Lizenz für Theater- und Opernaufführungen. „Der Spiegel“ diente bis 1961 auch als Grenzkino. Ab 1956 führte Kurt Wronna den Spiegel für die „Kurt Rilk Lichtspieltheater-Betriebe“ mit täglich zwei Vorstellungen, wöchentlich zwei Spät- und eine Zusatzvorstellung und monatlich eine Matinee-Vorstellung. Gleichzeitig erfolgte die Umstellung auf Breitwandfilme mit CinemaScope Vierkanal-Magnetton im Format 1:2,55. Ab 1959 führt Frau Herta Rilk das Kino als Inhaberin weiter. Nach einem Wechsel führte ab 1967 Fritz Seifert das Filmtheater bis zur Schließung 1973 weiter.[50][51] 1974 ist unter Drakestraße 50 im Branchenbuch „Real-Discount Cohn & Berndt“ eingetragen. Dabei wurden die kinotypischen Architekturelemente wie der Leinwandbogen und die Zuschauertribüne hinter Decken und Wänden versteckt. So wurde das Gebäude für 25 Jahre als Lebensmitteldiscounter genutzt.[Anm 1] Anfang 2004 beauftragte Frank Lüske (Biolüske) die Architekten Kleyer und Koblitz das Gebäude für einen Biomarkt umzugestalten. Die noch vorhandene Geschichte wurde nicht negiert und das Kinotypische blieb erkennbar. Auf der Erdgeschossfläche wurde der Biosupermarkt auf 500 m² angelegt. Die alte Zuschauertribüne wurde zu einer Eventlocation mit verschiedenen Nutzungen, so wurde mit Gaggenau und Poggenpohl das bundesweit erste Kochstudio in einem Biosupermarkt geplant. Die Fassade wie beim Kinoeingang ist erhalten. |
| Lichterfelde | Die Brücke ---- Hili-Filmtheater Hindenburg-Lichtspiele Welt im Licht (Lage) |
Hindenburgdamm 58a | 1913–1977 |  Die Vorführung von Tonfilmen erlaubte 1933 der Einbau der Tonwiedergabe unter dem Kinobesitzer Eugen Pollaczek. 1934 ist das Tonfilmtheater im Eigentum von Erich Bauer (Geschäftsführer Hans Conrad). Im Kino-Adressbuch 1937 ist wieder Otto Klung als Inhaber genannt, auf den die Bezeichnung „HiLi“ (für Hindenburg-Lichtspiele) zurückgeht. Die angegebene Platzkapazität liegt zwischen 385 und 391. Das Kino blieb ohne Kriegsschäden, wurde nur kurz unterbrochen und von Otto Klung in die Nachkriegszeit geführt. Den Betrieb führte Alfred Wittkopf. Er war auch tätig als Vorführer. Das Hili-Filmtheater hatte etwas über 400 Plätze. Für die Bühne von 5 m × 5 m × 6 m war eine Theater- und Opernlizenz vorhanden. Die Filmvorführung erfolgte mit einem Bauer-B6-Projektor und Bauer-Lorenz-Verstärkern. Zusätzlich war eine Dia-Projektion mit Ton vorhanden. Gespielt wurde täglich bei 15 Vorstellungen in der Woche. 1953 übernahm Fritz E. Croner das Kino mit seinem Geschäftsführer Arthur Ludwig. Dieser übernahm das Kino mit seiner Firma „Arthur Ludwig-Theaterbetriebe“[54] und baute das Hili auf Breitwand um. Neben tönendem Dia war auf dem Apparat Bauer B 6 (Lichtquelle: Xenon), AEG-Verstärkern und Klangfilm-Lautsprechern das Abspielen von CinemaScope Einkanal-Lichtton auf das Leinwandformat 1:2,35 möglich. Mit 21 Vorstellungen und einer Spätvorstellung konnten täglich Vorführungen für 353 Zuschauer auf Hochpolstersesseln gegeben werden. 1959 kam das Vorführsystem VistaVision hinzu. Die Arthur Ludwig-Theaterbetriebe führten das Kino weiterhin. 1967 erfolgte als Antwort auf die „Kino-Krise“ der 1960er Jahre eine Programm-Anpassung und die Umbenennung des Filmtheaters in „Die Brücke“. 1977 wurde das Haus endgültig geschlossen. Die Erdgeschossräume des viergeschossigen Wohnhauses werden seitdem als Ladengeschäfte durch verschiedene Firmen genutzt. |
| Lichterfelde | Gloria-Palast
(Lage) |
Hindenburgdamm 101a | 1949–1958 |  |
| Lichterfelde | Odeon-Lichtspiele
(Lage) |
Ostpreußendamm 78 | 1951–1962 | Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. Im Oktober 1961 wurde die Berliner Straße wegen des mehrdeutigen Straßennamens in verschiedenen Ortsteilen nach der Bildung von Groß-Berlin in Ostpreußendamm umbenannt. „In absoluter Randlage hatte es das stattliche Filmtheater nach dem Mauerbau sehr schwer.“ ([60]) Es wurde noch von Dipl.-Ing. Wehn aus Wilmersdorf betrieben, musste aber 1962 geschlossen werden. Dafür zog eine Discothek in das Gebäude ein: Tanzbar „White Horse“. Nach der zeitweisen Schließung der „Bellagia Diskothek“ (Siebert Gastronomie UG) folgte bis in die 2000er Jahre die Disko „AHA“,[61][62] der „Odeon-Club“ und bis in die zweite Hälfte der 2010er Jahre der „South Nightlife Club“.[63] Anschließend musste das Gebäude einem Wohnungsneubau weichen. |
| Lichterfelde | Palast-Lichtspiele
(Lage) |
Oberhofer Weg 1 | 1914–1983 |   1950 wurde wieder eröffnet mit 564 Plätzen durch Paul Fischer mit Walter Königsdörfer als Mitinhaber und beide führten die Geschäfte als Vorführer und Programmgestalter. Für die Bühne von 7 m × 2,7 m × 5 m bestand eine Theaterlizenz. Gespielt wurde täglich in zwei Vorstellungen dazu eine Spät- eine Jugendvorstellung wöchentlich, es waren der Vorführapparat Ernemann VII B und Verstärker Kinne, ab 1955 Uniphon vorhanden. Die Bestuhlung waren ungepolsterte Kamphöner-Kinoklappstühle. Die Firmierung der Inhaber war „Paul Fischer u. Sohn oHG Paul Fischer u. Walter Königsdörfer“. Zur Umrüstung auf Breitwand wurde 1957 die Technik neuangeschafft: zwei Ernemann VII B 2 in 2×rechts, Verstärker Zeiss Ikon Dominar M II, Lautsprecher Zeiss Ikon Ikovox D 3 Komb., so konnte CinemaScope in Einkanal-Lichtton und Vierkanal-Magnetton in den Formaten 1:2,35 und 1:2,55 abgespielt werden. Im Laufe des Jahres 1958 übernahm Erich Wolff das Kino und setzte den Betrieb der Palast-Lichtspiele mit den vorhandenen Bedingungen in den folgenden Jahren fort. 1982 wurde die Kapazität auf 504 Zuschauer gesenkt. „1. April 83 – Schließung: Berlin, Palast-Lichtspiele. Inh.: Erich Wolff“ ([66]) Das ehemalige Kino wird als Ladengeschäft (Euro-Shop) genutzt, an der Ecke besteht ein Bierlokal, im Wohnhaus befinden sich Ladengeschäfte im Erdgeschoss. Das gesamte Gebäude einschließlich ehemaligem Tanzsaal steht unter Denkmalschutz.[67] |
| Lichterfelde | Rex-Lichtspiele
(Lage) |
Unter den Eichen 57 | 1933–1968 | Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. 1957 wurde Johannes Betzel vom Inhaber des REX zum Pächter des Kinos und im gleichen Jahr löste Gertrud Prause den vorherigen Geschäftsführer Edgar Neumann ab. Ab 1960 war Betzel und Franzi als Pächter mit Elfriede Schaff als Geschäftsführerin tätig, bis sie 1968 den Spielbetrieb beendeten. Das Kinogebäude wurde nach der Schließung 1969[71] abgerissen und das Grundstück 56/57 des vormaligen „Lindenparks“ wurde beräumt. Bis 1973 wurde das Grundstück – nun als Unter den Eichen 57 – mit einem fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus neu bebaut, die 120 Meter Grundstückstiefe blieben als Grün-/ Gartenfläche erhalten und wurden um 1990 mit den Wohnhäusern 57a–57c in der Bebauung verdichtet. |
| Lichterfelde | Rio-Lichtspiele ---- Union (Lage) |
Gardeschützenweg 139 | 1920–1943 | Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. |
| Schlachtensee | Lumina-Filmtheater Schlachtensee
(Lage) |
Breisgauer Straße 17 | 1939–1969 |   |
| Steglitz | Adria-Filmbühne[83] ---- Schloßpark-Lichtspiele (Lage) |
Schloßstraße 48 | 1921–1943 seit 1952 |
 Das Schlossparktheater liegt mit dem „Gutshof Steglitz“ im Karree Schloßstraße 48 / Grenzburgstraße / Wulffstraße 1/5 / Wrangelstraße 2. Die Adresse des Adria ist Schloßstraße 48 (Eingang links neben dem Gutshaus Steglitz). Unter gleicher Adresse befanden sich 1921 bis 1943 die Schloßpark-Lichtspiele. Diese wurden 1921 im Schloßparktheater mit 1000 Plätzen von Paul Henckels und Hans Lebede eingerichtet. 1924 wurden Adolf Bellak aus Wilmersdorf (seit 1927 Lichterfelde) und Ernst Defries die Inhaber der Schloßpark Film- und Bühnenschau GmbH. Die Vorführungen der Schloßpark-Film- und Bühnenschau fanden an 3–4 Tagen der Woche statt, ab 1925 täglich. Das Kino bot 982/999 Plätze und hatte eine 10 m × 10 m große Bühne von 42 m² nutzbarer Fläche (8 m × 5 m). Für die Untermalung und Begleitung der Stummfilmvorstellungen wurde eine Kapelle von 10 Musikern eingetragen. Um der Tonfilmentwicklung zu folgen wurde 1931 die nötige Technik von Tobis eingebaut, es sind 1000 Plätze im Kino-Adressbuch für das Schloßpark-Tonfilmtheater verzeichnet. Die Geschäftsführer ihrer Gesellschaft sind Bellak und Defries. 1934 wird E. Bartsch geschäftsführer, 1937 ist die Schloßpark Steglitz Lichtspiele GmbH die Inhaberin mit 921 Plätzen, Geschäftsführer sind Lemke & Lautenbach & Co. Der Kinobetrieb der Schloßpark-Lichtspiele endete 1943 wegen kriegsbedingter Zerstörungen. Der Filmbetrieb ruhte bis 1952. „Nach einer Bauzeit von fünfeinhalb Monaten ist rechtzeitig zu Saisonbeginn Berlins Adria-Filmbühne fertig geworden. Der dritte Betrieb Arthur Ludwigs, der in Steglitz bereits die Albrechtshof-Lichtspiele und in Lichterfelde-West den Gloria-Palast besitzt. Außerdem gehören Arthur Ludwig drei Lichtspielhäuser in Hameln. Ein auf sechs Säulen ruhender Vorbau, der abends wirksam indirekt erleuchtet wird, empfängt die Besucher. Foyer und Zuschauerraum, der 630 Personen fasst, zeichnen sich durch eine betont schlichte Schönheit aus. Der Gesamtenwurf stammt von Architekt Hans Bielenberg. Die technische Einrichtung und Bühnentechnik von UFA-Handel, die Euronor-Junior-Lautsprecher- und Verstärkeranlage von Klangfilm. Der vorbildlich geräumige Vorführraum ist mit den neuesten Tonbild-Projektoren AP XII der Askania-Werke, Berlin-Friedenau, ausgerüstet.“ ([84]) Der Wiederaufbau war ein Kinoflachbau mit Foyer. Für die Bühne mit 8 m ×3,7 m ×6 m gab es eine Theaterlizenz. Gespielt wurden täglich drei Vorstellungen mit der Ausstattung: tönendes Dia, Askania AP XII, Klangfilm-Eurodyn G. Die Breitwandumstellung erfolgte 1957, dabei änderte sich die Bühnengröße: 10,5 m ×2,2 m. Die Bestuhlung bestand aus 620 Kamphöner-Hochpolstersesseln. Es kam eine Spätvorstellung hinzu. Als Bild- und Tonsystem nennt das Kino-Adressbuch CinemaScope Vierkanal-Magnetton im Format 1:2,55, und Einkanal-Lichtton auf 1:2,35, sowie Vista Vision. 1960 kam eine Schwerhörigenanlage und als Projektionsmaschine eine Bauer B 14 (Lichtquelle: Xenon), Klangfilm-Verstärker, Lautsprecher Bionor. 1971 ist die Adria-Filmbühne von Inhaber Arthur Ludwig (Berlin 41, Bismarckstraße 69) mit 500 Plätzen eingetragen. 1993 hatte die Adria-Filmbühne im Besitz der Adria Filmtheater Betriebsgesellschaft mbH von Peter Sundarp und Günther Mertins 376 eingetragene Plätze. Mit der „To the movies Filmverleih- und Filmtheaterbetriebs GmbH“ aus Kleinmachnow wird das Adria im Verbund mit der Cineplex-Gruppe betrieben. Sonntags findet regelmäßig eine Matinee mit dem Dokumentarfilm Berlin, wie es war aus den 1930er Jahren statt.[85] Der Saal wurde 1989 saniert, bei Innenraumausstattung und Foyer lag die Orientierung in den 1950er-Elementen. Das Kinogebäude wird über eine halbrunde Auffahrt mit Vorgarten erreicht, im eingeschossigen Vorbau befindet sich das Foyer mit dem quer angebauten Saalbau dahinter. Das große Foyer besitzt eine Verkaufstheke. Die Programmauswahl legt den Schwerpunkt auf amerikanische Mainstreamfilme. Das Kino besitzt 376 Plätze in 17 Reihen, die Projektion erfolgt in Digital 3D (D-Cinema 2K3D, 35mm analog ist vorhanden) mit Ton in Dolby Digital auf eine 24-m²-Leinwand (7,5 m ×3,2 m). Die roten Sessel von Reihe 1 bis 10 sind Klappsessel, ab Reihe 11 feste Sessel mit großem Reihenabstand. Von der letzten Sitzreihe ist der Filmvorführer zu shene, der vom Saal aus den Film startet. Auf dem Fußboden gibt es im Foyer Bodenfliesen mit dem eingravierten 'Adria'-Schriftzug, im Saal ist der blaue Teppich mit roten 'Adria'-Schriftzügen versehen.[86] Bilder des Kinobaus finden sich im Internet.[87][88] |
| Steglitz | Albrechtshof-Lichtspiele
(Lage) |
Albrechtstraße 1a | 1906–1967 |  Seit 1906[Anm 3] fanden wie damals in gastronomischen Einrichtungen üblich Vorführungen von Stummfilmen auch im „Hotel Albrechtshof“ statt.[Anm 4] 1912 eröffnete Herr Habermann in der Albrechtstraße 1a / Schlossstraße 82/83[89] im großen Saal im ersten Obergeschoss des Hofgebäudes vom Albrechthof die Lichtspiele mit 700 Plätzen. „Im großen Saal des Hotels ‚Albrechthof‘ eröffnete am vorigen Freitag Herr Habermann ein Kinotheater. Der Theatersaal ist elegant hergerichtet und ebenso wie die Vorräume mit rotem Teppich belegt. Die technische Einrichtung ist von Herrn Treder geleitet worden.“ ([90]) Der Albrechtshof war ein Gebäudekomplex (Hermann-Ehlers-Platz) mit Hotel, Restaurant und Theater,[91] der 1863 von Karl Friedrich Wilhelm Albrecht erbaut und 1967 für den Steglitzer Kreisel abgerissen wurde. Die „Reform-Lichtspiele im Albrechtshof“ führten ab 1913 Max Dillon & A. Melcher.[92] Das Kino-Adressbuch gibt dann 1917 Carl Lautenbach (Gastwirt, Hotelier) als den Inhaber der Albrechtshof-Lichtspiele.[93] Die Anzahl der Plätze der „Reform-Lichtspiele“ mit 650 an, gespielt wurde täglich und der Programmwechsel erfolgte wöchentlich, teilweise halbwöchentlich. Die Eintrittspreise sind mit 0,40 bis 2,00 RM angegeben. Ab 1920 sind die „Albrechtshof-Lichtspiele“ mit 700 Plätzen im Besitz von Wilhelm Reimer,[94] jedoch ist im Kino-Adressbuch 1924 wiederum Carl Lautenbach als Kinobesitzer verzeichnet. Über eine vierachsige, breite Halle gelangte der Besucher in das schmale, parallel dazu gelegene Foyer, von wo aus er über fünf Eingänge den Saal mit einer Galerie betreten konnte. Das Äußere des Gründerzeitbaus war nachts durch viele Leuchtröhren und Leuchtbuchstaben mit dem Namen „Albrechtshof-Lichtspiele“ illuminiert. „Mitte September 1924 zeigten die Albrechtshof-Lichtspiele im Vorprogramm zu einem amerikanischen Western den plastischen Film Plastigram – Der Film der dritten Dimension. Gratis verteilte Brillen verschafften den Zuschauern angeblich den Eindruck, als handle es sich auf der Leinwand nicht mehr um 'Bilder', sondern als träten Persönlichkeiten und Gegenstände in voller, plastischer Lebenserscheinung hervor.“ ([95]) 1927 lässt Lautenbach 850 Plätze und ab 1929 eine Saalkapazität für 909 Zuschauer eintragen. Die Vorführungen erfolgten täglich, es besteht eine 7 m× 7 m× 9 m große Bühne, die Kapelle zur Begleitung der Stummfilme besteht aus 12–15 Musikern, später noch 5–11. Es wurden Filmvorträge zu Stummfilmen gehalten: wie Anfang Dezember 1927 mit dem Vortragsredner Kapitän Gottfried Speckmann in einer Sonntags-Matinee um 11 Uhr für den Kulturfilm Das schaffende Amerika. 1930 ist die „Albrechtshof Lichtspiele GmbH“ als Inhaberin des Kinos angegeben. Tonfilme waren ab 1931 durch Kinoton ermöglicht. 1937 ging das Kino an die Albrechtshof-Lichtspiele Brammer & Co. mit dem Geschäftsführer Hans Brammer. Die Platzkapazität war 893…871. Ab 1939 tritt zu der „Albrechtshof-Lichtspiele Brammer & Co.“ der Berliner Kinobesitzer Hugo Lemke zu. Durch Kriegseinflüsse entstanden schwere Schäden an den Gebäuden. Nachdem 1948 der Kinosaal schlichter und ohne die ehemalige Galerie mit noch 480 Sitzplätzen hergerichtet wurde, ging der Kinobetrieb in den Nachkriegsjahren weiter. Betrieben wurde das Nachkriegskino durch „Brammer und Groth“, 1950 sind die Besitzrechte übergegangen in die „Lichtspielbetriebs-Gesellschaft Albrechtshof Steglitz mbH“ mit Artur Lehmann, Hans Brammer und Hans Moldmann als Registrant. Ausstattung waren der Ernemann-Apparat und der Klangfilm-Verstärker Eurodyn. Es gab täglich drei Vorstellungen. Ab 1952 sind 480 Plätze, als Projektor eine Askania APXII und die Theaterlizenz für die Bühne von 8 m× 3 m× 5 m eingetragen. Im Weiteren (1955) bestanden 530 Kinoplätze mit Hochpolsterklappsesseln von Kamphöner. Der Askania-Projektor ermöglichte die Wiedergabe im Bild- und Tonsystem CinemaScope Vierkanal-Magnetton im Breitwandformat 1:2,55, und in Einkanal-Lichtton auf Größenverhältnis 1:2,35. In diesem Jahr kam eine Spätvorstellung hinzu. Für 1960 ist ein (neuer) Projektor Bauer B 14 mit Xenon-Lichtquelle aufgenommen. In dieser Konstellation sind die Albrechtshof-Lichtspiele (hier vermerkt: amerikanischer Sektor, Steglitz) bis 1967 erhalten. Um Baufreiheit für den Kreisel zu erreichen wurden die Gebäude auf dem Gelände Schloß-/ Albrecht-/ Kuhligkshofstraße im Nordwesten des Bahnhofs Steglitz (ehemals der südliche Teil des Gutsdorfes Stegelitz) abgerissen.[96] Weitere Quellen und insbesondere Bilder liegen im Internet.[97][98][99] |
| Steglitz | Allegro
(Lage) |
Bismarckstraße 69 | 1957–1985 | Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. „Selten genug, daß dem besonderen, dem künstlerischen Film ein eigenes Haus zur Verfügung gestellt wird. Noch seltener, daß man ihm ein Kino extra baut. So geschah es jetzt in Berlin-Steglitz, wo die Arthur Ludwig-Theaterbetriebe in der Bismarckstraße, am Lauenburger Platz, mit dem Allegro ein ausgesprochenes Studio-Theater eröffneten. Ein niedriger, schlichter, langgestreckter Bau, den ein Übergang mit dem bereits seit langem existierenden Apollo-Filmtheater des gleichen Unternehmers verbindet — das ist das Allegro. Architekt Hans Bielenberg schuf damit für Steglitz ein wahres Schmuckstück. Durch das Foyer, das vom Kassenraum durch mehrere Stufen getrennt ist, erreichen die Besucher das Parkett, das 468 Plätze enthält. Pastellfarbene Wände lenken die Aufmerksamkeit nicht von der breiten Leinwand ab. Das Innere des Raumes ist von betonter Zweckmäßigkeit, auf übermäßige Pracht wurde verzichtet. Ein Studio-Theater ist kein Luxustheater. Die technische Einrichtung des Hauses lieferten Siemens & Halske, Abteilung Klangfilm, und die Märkische Maschinenfabrik. Bestuhlung: Heinrich Kamphöner. Akustik-Platten: Werner Genest. Bauleitung: Erhard Klöckling. Wahrer Kundendienst ist der private Parkplatz des Allegro, für den ein komplettes, eingezäuntes und mit Peitschenlampen ausgestattetes Baugrundstück verwendet wurde. Mindestens 60 Wagen der Filmkunst-Freunde können hier parken. Die Arthur Ludwig-Theaterbetriebe umfassen jetzt acht Häuser: fünf davon in Berlin (Allegro, Apollo, Adria, Heli, Albrechtshof) und drei in Hameln (Deli, Capitol, Schauburg). Schon das Allegro-Eröffnungsprogramm bot Besonderes: die Berliner Uraufführung des spanischen Films ‚Calabuig‘ (Verleih: RKO).“ ([100]) Das „Allegro“ hatte mit dem Zusatz „Haus der Filmkunst“ noch bis zum Schließtag am 28. Juli 1985 geöffnet. Anschließend wurde der Kinosaal noch als Kirchenraum weitergenutzt. Es folgte der Abriss des Kinogebäudes um 1990 – das Apollo an der Straßenecke etwas später. Danach wurde eine sechsgeschossige Wohnhausreihe mit Ladenflächen errichtet, die von der Horst-Kohl-Straße 18/19 in die Bismarck- und die Kissinger Straße reicht. Bilder zum Kino sind quellenberechtigt im Internet vorhanden.[101][102] |
| Steglitz | Apollo-Filmbühne
(Lage) |
Bismarckstraße 68 | 1954–1977 | Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. „Aushängeschild und Wegweiser bei Einbruch der Dunkelheit war der hell erleuchtete Rundvorbau aus Glas mit Kassenhalle. Die gelbe Decke und grauweiße Wände des Foyers kontrastierten mit in Form eines modernen Teppichmusters aufgeteilten Fußboden. Eine mit grauem Acellastoff abgeschlossene Garderobe, der Verkaufsstand, eine Sitzbank sowie beleuchtete Spiegel mit eingebauter Kassettendecke gaben dem Raum eine gediegene Note. Der Zugang zum Zuschauerraum erfolgte für Nachzügler bei Beginn der Vorstellung durch abgedeckte Lichtschleusen. Unter Verzicht auf eine kostspielige Rangkonstruktion wurde ein von der Mitte ansteigendes Hochparkett geschaffen. Nach dem Öffnen des Hauptvorhanges lief der Acella-Stoff der Saalbespannung als Schürze und Bildvorhang weiter, so daß der Eindruck entstand, Theatersaal und Bühne seien eng verbunden. Für die Dekorationsarbeiten war Paul Döhler zuständig. Ein geräumiger Vorführraum mit den erforderlichen Nebenräumen gaben der Theaterleitung die Möglichkeit, die modernsten Maschinen (B12), Schmalfilmprojektor sowie eventuell nötige zusätzliche Einbauten vorzusehen.“ ([104]) Bilder und Fotos vom Kino liegen auf Internetquellen.[105][106] |
| Steglitz | Asta-Lichtspiele
(Lage) |
Thorwaldsenstraße 26 | 1914–1959 |  |
| Steglitz | Bismarck-Lichtspiele
(Lage) |
Poschinger Straße 15 | 1929–1943 | Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. |
| Steglitz | Deutsches Theater
(Lage) |
Albrechtstraße 132 | 1910–1929 |   |
| Steglitz | Filmburg ---- Palast-Theater Weltstadt-Theater (Lage) |
Schloßstraße 92 | 1910–1943 | Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. |
| Steglitz | Flora-Lichtspiele
(Lage) |
Schloßstraße 10 | 1910–1966 | Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. Als Jahr der Gründung der Flora-Lichtspiele ist 1910 genannt, als im Haus Schloßstraße 9/10 der Kaufmann Metz tätig war, welches diesem gehörte (Metz & Co. Etablissement für Land-, Forstwirtschaft u. Gartenbau. Samenhandlung, Samenculturen, Baumschulen. Steglitz bei Berlin). Nach den Eintragungen im Berliner Adressbuch[134] wurde auf dem Grundstück ausgebaut. Im Berliner Adressbuch ist explizit Robert Wiesener für Kinematograph aufgenommen.[135] Das Kino-Adressbuch nennt 1918 Robert Wiesner als Inhaber des Flora-Kinos, es hat 200 Plätze und wird täglich bespielt, 1920 mit Teilhaber als Kopp & Wiesner. Ab 1924 besaß Hugo Lemke auch das Flora, wobei es 1927 ebenfalls (wie andere Lemke-Kinos) zur National-Film-Theater GmbH gehörte. Es war eines der Filmtheater von Hugo Lemke, das zur „Steglitzer Kinobetriebe Hugo Lemke & Co.“ gehörte. Das Platzangebot wurde leicht angepasst: ab 1925 mit 207, ab 1928 mit 208, ab 1937 mit 212 Plätzen. Das Eckhaus Schloßstraße blieb im Krieg unzerstört und in den Nachkriegsjahren wurde der Spielbetrieb weitergeführt. 1949 ist Walter Hilpmann als Inhaber genannt, doch ab 1952 wieder Hugo Lemke und Jakob Laupheimer. Die Firmierung ist „Filmtheaterbetriebe Hugo Lemke u. Co. KG“ und Walter Loewié ist der Geschäftsführer im Flora. Die Kinotechnik für zunächst 1950 täglich zwei Vorstellungen ist der Projektor Ernemann II und Verstärker Klangfilm-Europa, dazu die Dia-Projektion mit Ton. Die Intensität der Vorführungen steigt ab 1952 auf 28 und ab 1953 auf 41 Vorstellungen je Woche. Die Bestuhlung sind 212 ungepolsterte Klappsitze. Nach 1958 werden Breitwandfilme im Format 1:2,35 ermöglicht. Dazu ist ein Projektor AEG Triumphator und ein Erko IV angeschafft für Filme mit dem System CinemaScope und Einkanal-Lichtton. Das Kino wird nach Eigentumsansprüchen schließlich 1966 geschlossen. |
| Steglitz | Globus-Palast Südende
(Lage) |
Borstellstraße 1 | 1927–1943 |  Das Grundstück Nummer 13 ist für 1926 als Garten bezeichnet, 1927 wurde das Gebäude mit dem Globus-Palast im Erdgeschoss des Kopfbaus errichtet.[136] Der Globus-Palast bot 380 Plätze für Zuschauer bei täglichen Vorstellungen. Der Inhaber des Kinos ist nach Kino-Adressbuch der Hausbesitzer Cargher, seine Geschäft führte Fritz Porten.[137] Im Folgejahr hat Fräulein Effi(Iffi) Engel den Globus-Palast[138] als Inhaberin übernommen.[139] Sie eröffnete 1929 auch die Bismarck-Lichtspiele. 1931 noch als Inhaberin[140] genannt, wurde die Tonfilmvorführung mit Klangfilm eingeführt. 1932 übernehmen das Kino Hans und Walter Meyer als Inhaber nun unter der Adresse Borstellstraße 1. Das Kino-Adressbuch 1937 führt schließlich Georg Schibalski als Inhaber. Er gestaltete das Kino um und eröffnete mit einer Kapazität von 343 Plätzen die Globus-Lichtspiele am 1. April 1935 neu. Zeitweise waren Rütthard und Rudzki seine Teilhaber. Im August 1943 wurde Südende nahezu vollständig durch Bomben zerstört. Das Kinogebäude wurde am 24. August 1943 getroffen, wodurch die Vorstellungen endeten. Die Ruinen wurden um 1950 beräumt. Außer einzelnen Ausbauten in der Umgebung erfolgte die Neubebauung erst 1960, wobei die Straßenführung geändert wurde. Das 1960 errichtete Wohnhaus Borstellstraße 1/3 liegt dadurch auf dem Grundstück Liebenowzeile 2. Das Grundstück des Globus-Palastes wurde zur Grundstücksfläche Borstellstraße 2/Liebenowzeile 1 / Steglitzer Damm 76 und wurde um 1970 mit dem Flachbau für das Postamt 414 besetzt. Das Postamt zog um, der Flachbau wird als Ladengeschäft (2008 durch Video World) genutzt. |
| Steglitz | Häsi-Lichtspiele ---- Regina-Lichtspiele (Lage) |
Steglitzer Damm 23 | 1931–1962 | 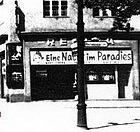  Bei den Luftangriffen wurden anschließende und gegenüberliegende Häuser der Worpsweder Straße zerstört und um 1950 die Grundstücke beräumt. Mariendorfer Straße 43–46 und Worpsweder Straße 19 und 21 blieben erhalten. So wurde der Kinobetrieb[144] nach kurzer Unterbrechung in den Nachkriegsjahren weitergeführt. Die Regina-Lichtspiele verblieben in den Räumen zur Worpsweder Straße entlang, im Adressbuch weiterhin mit 250 Plätzen aufgenommen. Max Vatter ist 1950 der Inhaber des Kinos und wählte den neuen Namen „Häsi-Lichtspiele“ mit 254 Plätzen. Die Mariendorfer Straße und die östlich fortsetzende Steglitzer Straße wurden 1957 in Steglitzer Damm umbenannt, die Kinoadresse änderte sich zu Steglitzer Damm 23. Ab 1958 wurde wie anderswo Breitwandtechnik für das Bild- und Tonsystem CinemaScope Einkanal-Lichtton im Bildformat 1:2,35. Neben den Klangfilmverstärkern gb es einen Projektor Erko IV und Dia-Einspielung mit Ton. Gespielt wurden 17 Vorstellungen und eine Matinee- und eine Spätvorstellung. Die vorhandenen 249 Plätze waren Flach- und Hochpolsterklappsessel von Kamphöner und Bähre, sowie (wohl teilweise) von Schröder & Henzelmann. Max Vatter beendete den Betrieb der Lichtspiele 1962. Das ehemalige Kino wurde in ein Ladengeschäft umgewandelt. |
| Steglitz | Kammerspiele ---- Lichtspielhaus Südende (Lage) |
Sembritzkistraße 7 | 1919–1943 | Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. 1919 eröffnete das „Südende-Lichtspielhaus“ (2) in der Lichterfelder Straße 21 (seit 1957: Sembritzkistraße 5).[146] 1) Das Grundstück Potsdamer Straße 22 (seit 1933: Benzmannstraße 31) von Südende gehörte vor der Bildung von Groß-Berlin (politisch) zu Steglitz, während die Gemarkung Südende eine Ortslage zu Mariendorf (Kreis Teltow) war. Noch 1910 ist das Grundstück Potsdamer Straße 22 als Bauland 16–18 ausgewiesen und als 17 nummeriert.[147] 1911 ist das Wohnhausensemble Potsdamer Straße 22 und 23 mit seinen neun Aufgängen im Eigentum von Architekt Raubert (aus Nr. 23) aufgebaut und teilweise bereits vermietet worden. So hatte das Kinematographentheater frühestens ab 1911 bestanden. Im Besitz der Häuser 22 und 23 wurde der bauende Architekt durch Direktor Küsel, ab 1915 die verwitwete Frau Direktor G. Küsel abgelöst. Im Kino-Adressbuch ist noch 1921[148] das Kino „Südender Lichtspiele“ mit 170 Plätzen und täglichen Vorstellungen bezeichnet. In folgenden Kinoadressbüchern ist kein Kino an dieser Adresse benannt. Inhaber ab 1918 war Heinrich Ziegenspeck aus der Fregestraße 49.[149] Der Kinobetrieb wurde (wohl) im Jahr 1921 eingestellt. Als die Straße 1933 umbenannt wurde ergab sich eine Änderung der Adressdaten der Aufgänge der Potsdamer Straße 22 zu Benzmannstraße 31–31c. Bei den Luftangriffen auf Südende wurden auch die Wohnhäuser der Benzmannstraße zerstört, insbesondere das vormalige Gebäude mit dem Kino. Beräumt wurden die Ruinen spätestens 1959 und 1962 erfolgte eine lockere Neubebauung (Quartier Liebenowzeile). Das achtgeschossige Wohnhaus Benzmannstraße 31 liegt ungefähr über der Kinogrundfläche. 2) 1919 eröffneten die „Südender Lichtspiele“ in der Lichterfelder Straße 21 am westlichen Rand von Südende, das damals zu Mariendorf gehörte.[150][151] Inhaber des „Lichtspielhauses Südende“ war mindestens ab 1924 die „Steglitzer Metropol-Lichtbildbühne GmbH“ mit Geschäftsführer Max Victor. Das Kino bot 200 Plätze und wurde täglich mit zwei Wechseln des Programms (dienstags und freitags) bespielt. 1928 wurde Walter Krüger der Inhaber. Im November 1927 entzündete sich ein Film im Projektorraum und das Lichtspielhaus Südende wurde gestört, doch bis Ende des Jahres wurde das Kino mit erneuerter Ausstattung wieder eröffnet.[152] Als Karl Bornemann die Film-Spielstätte im Jahre 1933 übernahm erweiterte er die Anzahl der Plätze auf 330 und änderte den Namen seines Kino in „Kammerlichtspiele“. Bis 1937 wurde Georg Schibalski, der bereits Kinos besaß, der Inhaber der „Kammerspiele“ – nun Doellestraße 73/74. 1938 kurzzeitig Georg Schibalski, Rütthard und Rudzki. Das Kino blieb im Besitz von Schibalski, bis der Betrieb eingestellt werden musste. Im August 1943 wurde Südende nahezu vollständig durch Bomben zerstört. Dadurch war der weitere Betrieb nicht mehr möglich. Am 18. September 1934 war die Lichtenrader Straße in Doellestraße umbenannt worden und das Kinogrundstück zu Doellestraße 72/74. Am 31. Juli 1947 erfolgte die Umbenennung in Priesterweg 72/74. Im Zusammenhang mit der Bebauung der kriegszerstörten Flächen in Südende mit Wohngebäuden in grüner Umgebung erfolgte die erneute Straßenumbenennung in Sembritzkistraße, der vierteilig viergeschossige Wohnblock auf der Grundfläche des vormaligen Kinos erhielt die Adresse Sembritzkistraße 1–7. |
| Steglitz | Laterna-Filmtheater
(Lage) |
Kieler Straße 7 | 1948–1962 |  Das Laterna-Filmtheater eröffnete 1948 in der Trägerschaft der Laterna Filmtheater GmbH mit Geschäftsführer Helmut Galling. Das Kino hatte 400 (389) Plätze und eine Bühne von 6 m × 2 m × 4 m Größe für die eine Theaterlizenz bestand. Anfangs wurden täglich zwei Vorstellungen gegeben, ab 1952 21 Wochenvorstellungen (drei Vorstellungen täglich) und 1957 kamen Spät- und Matiné-Vorstellung hinzu, Matinee als Jugendvorstellung, ab 1960 zwei Spätvorstellungen. Beim Kinostart war ein Ernemann VII B-Projektor und der Verstärker 2 Kine aufgebaut mit zusätzlich einer Dia-Projektion. Ab 1952 sind eine Bauer B6 und Klangfilm-Verstärker (Klangfilm-Europa) und Dia mit Ton installiert. Als Inhaber ist 1952 bis 1956 Friedrich Rust mit seinem Geschäftsführer Helmut Galling benannt und 1957 übernahm Sophie Rust den Kinobesitz und blieb Inhaberin bis zum Betriebsende 1962. 1957 wurde noch die Breitwandvorführung mit Bild- und Tonsystem CinemaScope Einkanal-Lichtton auf 1:2,35 aufgerüstet, zudem auch 1:1,85. Die 389 Kinosessel von Kamphöner waren teils Hochpolster und teils Halbpolster. Das Wohnhaus Kieler Straße 7[153] befand sich zwischen Düppelstraße und der Bahnstrecke (Wannseebahn). 1948 wurde ein Flachbau hergerichtet, der als Kino eingerichtet wurde. In Vorbereitung des Baus der Autobahn A 103 wurden die Bauten zwischen Düppelstraße und Bahn abgerissen um Baufreiheit zu erreichen. Diesem Abriss fiel auch das Laterna-Filmtheater zum Opfer. Dadurch befindet sich das vormalige Grundstück seit 1965 im Bereich der beiden Fahrbahnen. |
| Steglitz | Lida-Lichtspiele
(Lage) |
Breitenbachplatz 21 | 1933–1965 |  |
| Steglitz | Metropol-Theater
(Lage) |
Schloßstraße 31 | 1907–1922 |  1907 betreibt der Kinematographenbesitzer Gustav Klunter[163] sein Gewerbe in der Schloßstraße 31. Ihm folgte als Besitzer des Kinematographen[164] Fritz Elsner mit dem Kinematographentheater, der noch in den beiden Folgejahren Besitzer und Betreiber war.[165] Für das Jahr 1912 war die „Metropol-Kino GmbH“ mit ihrem Sitz eine von zwölf Mietern, 1913 bis 1915 betrieb Elsner in der Schloßstraße 31 einen Filmverleih am Standort seines Kinematographen.[166] 1916 kamen die Makler Charlet & Schulze in den Besitz der Nachbarhäuser Schloßstraße 31 und Miquelstraße 32, Elsner zog mit dem Filmverleih in die Miquelstraße 32 um.[167] In der Schloßstraße 31 wohnte der Theaterbesitzer Eugen Pleßner (Firma Palast-Theater Eugen Pleßner in der Schloßstraße 92).[168] Aus dem Adressbuch 1920 ergibt sich, dass in der Schloßstraße 31 der Inhaber des Palast-Theaters (Schloßstraße 92) Eugen Pleßner wohnt, der Betreiber des Metropol-Lichtbild-Theaters Kaufmann Georg Müller wohnt in der Miquelstraße 29/30. Im Haus an der Ecke Miquelstraße wohnt Kinobesitzer Fritz Elsner mit Filmverleih. Im Kino-Adressbuch 1918 ist Kaufmann Georg Müller (Miquelstraße 30) als Inhaber eingetragen, nach seinen Angaben im Kino-Adressbuch hatte er das Metropol-Lichtbild-Theater 1912 übernommen. In den folgenden Kino-Adressbüchern gibt er 1907 als Gründungsjahr an. Das Kinematographentheater besaß 200 Plätze[169] und es wurden an jedem Tag der Woche Filme vorgeführt. Im Besitz von Müller wurde der Kinobetrieb 1922 eingestellt.[170] Der Name „Metropol“ ging nach 1922 von der Schloßstraße Hugo Lemke dem Inhaber der Firma „Steglitzer Metropol-Lichtbühne GmbH“. |
| Steglitz | Palast-Theater (Am Stadtpark) ---- P.-T.-Lichtspiele (Lage) |
Albrechtstraße 91 | 1911–1943 |  |
| Steglitz | Park-Lichtspiele
(Lage) |
Albrechtstraße 49 | 1930–1968 | Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. Seit der Eröffnung der Park-Lichtspiele mit 1000 Sitzplätzen war die Vorführung von Tonfilmen mit Kinotechnik von Tobis möglich. Inhaber war mit der Eröffnung die „Park-Lichtspiele GmbH“. Geschäftsführer war Ernst Jäger.[182] Gespielt wurde täglich. Es gab eine Bühne von 12 m × 8 m. 1932 übernahmen Iffi Engel und Frau Gisa Rachmann, die bereits im Kinogeschäft (vergleiche auch Globus-Palast) tätig waren, die Palast-Lichtspiele GmbH. Ihnen folgte für 1933 und 1934 in den Besitzrechten – wie im Kino-Adressbuch eingetragen – die „Kino Waren GmbH“.[183] Im Berliner Adressbuch 1936 ist das Grundstück 49 (wie auch 48) im Besitz der „Industria (Treuhand) Verwaltungs Akt. Ges.“ (W 62, Budapester Straße5) und wird von der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank verwaltet. Einziger Grundstücksnutzer sind die Park-Lichtspiele. In weiteren Adressbüchern lautet der Eintrag „Eigentümer ungenannt“, als Nutzer Garagen und Park-Lichtspiele. Für das Jahr 1937 nennt das Kino-Adressbuch als Inhaber Hans Brammer, die „Albrechtshof-Lichtspiele Brammer & Co.“[184] Das Kino ist im weiteren mit 943 Plätzen ausgelegt. Das Adressbuch von 1943 nennt für die Park-Lichtspiele (sowie die Garagen) das Grundstück 49, Sie sind im Gewerbeteil genannt. Im Einwohnerteil ist Hans Brammer nicht, wohl aber die Albrechtshof Lichtspiele Brammer & Co., von denen die Parklichtspiele betrieben werden.[185] Ab 1949 spätestens waren die Park-Lichtspiele in Betrieb, wohl zunächst unter der Lizenz bevor die Universum-Film AG (Herr Feldes, Berlin-Tempelhof, Viktoriastraße 13–18) mit Theaterleiter Kurt Mercker als Geschäftsführer als Inhaber eingetragen ist. Mit 942 Plätzen wurden im Kino täglich zwei Vorstellungen gegeben. Die Filmtechnik war Zeiss-Ikon-Projektor, Klangfilm-Verstärker und Dia mit Ton. Die Theater- und Opernlizenz bestand weiterhin. 1955 sind zwei Ernemann VII B (Lichtquelle: Becklicht) und für den Ton Klangfilm Europa Junior angesetzt. Zudem kamen jede Woche vier Vorstellungen hinzu. Im Laufe des Jahres 1956 wird der Verstärker von Quante angeschafft, wodurch das Breitwand-System mit Lichtton möglich war. Die Breitwand der Art Ideal II in der Abmessung 8,5 m × 4,6 m ließ Filme im Format 1:1.85 zu. Zudem wurde die Anzahl der Vorstellungen auf 21 erhöht. 1961 sind es 23 Vorstellungen als die Arthur Ludwig-Theaterbetriebe das Kino übernehmen. Es gibt donnerstags einen FK-Tag. Bei der Übernahme wurde die Kinotechnik ergänzt und erneuert: Projektionsapparat Bauer B 14, Verstärker Klangfilm, Lautsprecher Bionor, Dia-N. In Breitwandtechnik Vista-Vision sind Licht- und Magnetton möglich und die Breitwandformate 1:1,85 und 1:2,55. 1968 wurde der Kinobetrieb eingestellt. In Internetquellen finden sich Bilder vom Kino.[186][187] |
| Steglitz | Schlossparkkino
(Lage) |
Schloßstraße 48 | 1921–1943 | Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. |
| Steglitz | Titania[188]
(Lage) |
Gutsmuthsstraße 28 | seit 1928 |    Als 1908 ein Rummelplatz am Nordende der Schloßstraße auf dem Marktplatz zwischen Friedenau (zu Schöneberg) und Steglitz stattfand,[189] gab es am Ort zeitweise ein ambulantes Kino. 1927 erwarb die Grundstücks-Theater-Betriebsgenossenschaft für die National-Film AG ein Grundstück am Rand von Friedenau[Anm 10] an der Schloßstraße (Ecke Gutsmuthsstraße 28).[190] Nach Entwürfen der Architekten Schöffler, Schloenbach und Jacobi wird das Großkino mit 1924 Plätzen in 30 Monaten erbaut.[Anm 11] Eröffnet wurde am 26. Januar 1928 mit einer Festvorstellung.[Anm 12] Die Stars des Eröffnungsfilms Der Sprung ins Glück, ein Stummfilm mit Carmen Boni und der in Steglitz lebende Hans Junkermann, sowie Martha Sonja, Otto Gebühr und Hans Brausewetter waren anwesend.[191] Das Gebäude wurde in der Liste der Baudenkmale eingetragen.[192] Die Außenfassade ist originalgetreu erhalten geblieben, mit dem Cineplex-Kinocenter wurde zum ursprünglichen Saal[193] stark verändert.[194] Außer dem Kinoprogramm gab es regelmäßig Theater und Konzerte im Saal. Inhaber des Titania-Palastes war die National-Film-Theater GmbH mit Sitz in SW 48, Friedrichstraße 10.[195] Gespielt wurde täglich, die Kapazität war für 1900 Zuschauer angegeben, die Tonfilmtechnik kam von Klangfilm. Am 29. Oktober 1929 wurde mit dem Film The Singing Fool der erste Tonfilm gespielt, bis dahin erfolgte die musikalische Untermalung durch das 50–60 Mann starke Kino-Orchester.[188] „Die Leitung des Titania-Palastes schwenkt […] schon früh auf die neue, nationalsozialistische Linie ein […] Am Volkstrauertag 1933, dem 12. März, findet im Titania-Palast eine große, vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge veranstaltete statt, die in ihrem an einen Toten-Kult erinnernden Stil ganz im Sinne des Nazi-Ideologie entspricht.“ Das Grundstück wurde an die Tolirag (Ton-Lichtbild-Reklame AG) verkauft, die wiederum die Hälfte an Hugo Lemke, die Titania-Palast-Gesellschaft weitergab.[188] Das Großkino war mit 1915 Zuschauerplätzen und täglichen Vorstellungen, die Bühne mit 123 m² benannt. In den Berliner Adressbüchern ist die Gutsmuthsstraße 27/28 der Schloßstraße 4 zugeordnet, die Gemarkungsgrenze rückte von der Nordseite Mommsenstraße an die Südbebauung der Gutsmuthsstraße und der Titaniapalast lag Anfang der 1930er Jahre in Friedenau (Verwaltungsbezirk Schöneberg) und wurde mit der Bezirksreform 1938 zu Steglitz zugeordnet.[Anm 13][196] Noch 1944 wurde der Titania-Palast neben weiteren Lichtspielhäusern zu Gunsten der UFA enteignet. Der Titania-Palast blieb im Krieg unzerstört, und schon im Mai 1945 spielten die Berliner Philharmoniker im Haus. Die Rolle der UFA im NS-System führte dazu, dass unter Besatzungsstatus Filmtheater im amerikanischen Sektor unter die Verwaltung der „USA Finance & Property Control“ (Sitz in Tempelhof, Viktoriastraße 15–18) kamen, die im August 1948 das beschlagnahmte Haus wieder deutscher Nutzung übergaben. Lemke bekam sein Eigentum zurück und verpachtete an den Senat. 1949 wurde der Saal zur Verbesserung der Akustik durchgreifend umgebaut, im September 1949 wurde er als Konzertsaal wiedereröffnet.[197] 1951 kam die Berlinale in den Titania-Palast. 1953 folgte ein weiterer Umbau: Auf dem Nachbargrundstück wurde ein Bühnenhaus errichtet, die Bühne wurde vergrößert und die alte Kuppel an der Decke des Zuschauerraumes entfernt und die Vorführung mit Cinemascope ausgestattet. Die Pacht des Senats endete 1954, und ein Kauf kam nicht zustande, da die Pläne für den Aufbau des Opernhauses bereits standen. Der Titania-Palast blieb bis in die 1960er Jahre Veranstaltungsort für Konzerte, Theateraufführungen und Filmprogramme, es bestand die Opern- und Theaterlizenz für die Bühne 11 m × 14,5 m × 20 m große Bühne. Inhaberin war die „Titania-Palast-Ges. Hugo Lemke“. Die Filmtechnik für CinemaScope waren die Bauer B12, 4-Kanal-Verstärker Eurodyn und tönendes Dia in allen Formaten, Leinwand ist eine 5,8 m × 13,8 m große Breitwand MMS (Bild- und Tonsystem Einkanal-Lichtton und Vierkanal-Magnetton auf 1:2,35 und 1:2,55). Möglich sind CinemaScope, Cinerama, Cinemiracle, Todd-AO, 1962 folgte die Philips-70mm-Anlage; der erste Film in 70mm war Spartacus von Kubrick in Super Technirama. Wöchentlich gab es 16 Filmvorstellungen für die 1866 Zuschauerplätze, die Bestuhlung waren Polstersitze von Otto & Zimmermann. 1956 wurde Erich Hoffmann (Tegel, Bahnhofstraße 1) der Geschäftsführer. Als sich die finanzielle Situation mit der neuerbauten Oper und der Philharmonie verschlechterte, sollte 1963 das Berliner Operetten Theater entstehen. Es folgte ein erneuter Umbau: der Saal wurde um 400 Plätze verkleinert, die Bühne vergrößert, das Foyer verändert. Im alten Foyer und der zweiten Kassenhalle richtete die BEWAG eine Geschäftsstelle ein. 1965 wurde das Operettenprogramm eingestellt, das Gebäude an Karl-Heinz Krüger-Quiring verkauft, der die Flora an den Karstadt-Konzern für ein Warenhaus verlor. Quiring verkaufte im Juni 1965 an den Otto-Versand weiter, der es für sein Warenhaus abreißen wollte. So endete der Kinobetrieb vorerst am 13. Dezember 1965 mit dem 1958 teilweise im Titania-Palast gedrehten Film Das gab's nur einmal. Durch den Mietvertrag der BEWAG bis 1983 blieb das Traditionshaus vom Abriss verschont. Mit dem Verkauf an die Aktiengesellschaft für Haus- und Grundbesitz 1967 wurde das Haus in Geschosse aufgeteilt, das Innere entkernt und mehrere Läden eingerichtet, der Saal des Titania wurde durch die Anpassung für Einzelhandelsgeschäfte zerstört. Es blieben im Obergeschoss einige Sitzreihen des ehemaligen Rang für ein zukünftiges Kino erhalten. Statt eines neuen Lichtspielhauses nutzten 1972 bis 1994 die städtischen Bühnen das Haus als Probebühne. Das Haus mit Ausnahme der Läden im Erdgeschoss und der äußeren Leuchtwerbung wurde 1984 unter Denkmalschutz gestellt.[188] Mit der Schließung der Probebühne begann der Umbau zum Multiplex mit fünf Kinosälen (Saal 1 bis 5), die am 24. Mai 1995 eröffnet wurden. Mitte August 2007 wurden zwei weitere Säle gegenüber Saal 2 und 3 im 'Titania Palast' eröffnet. Die Betreibergesellschaft „To the Movies“ (Filmverleih- und Filmtheaterbetriebs GmbH Klein-Machnow) der Geschäftsführer Günther Mertins und Peter Sundarp änderte 2008 den Traditionsnamen in „CINEPLEX-Titania“. Der letzte Umbau fand 2013 bei laufendem Betrieb statt. „Seit der Renovierung 2014 zeigen sich die sieben Säle des Multiplex-Kinos in individueller Ausstattung und mit mehr als 1200 Sitzplätzen.“[198] Die Adresse ist Schloßstraße 4–5, 12163 Berlin-Steglitz, der Eingang liegt in der Gutsmuthsstraße 28, so weist eine Inschrift an der Wand und ein Pfeil zum Eingang. Die Projektion in den Sälen erfolgt digital, außer Saal 4 und 5 in 3D-digital (D-Cinema 2K3D), und Saal 2 bietet zudem HFR. In allen Sälen gibt es Dolby Digital 7.1. Behindertengerecht ist lediglich Saal 1.[199] Die 1222 Plätze im Cineplex verteilen sich auf die sieben Säle[200]
An die Theatertradition des Titania knüpfen Live-Übertragungen von Opern-, Theater- und Ballettaufführungen etwa aus dem Moskauer Bolschoi-Theater oder dem Royal Opera House in London.[198] Weitere Bildergalerie unter dem folgenden Nachweis.[201] |
| Steglitz | Wrangel-Lichtspiele
(Lage) |
Schloßstraße 48 | 1934–1945 |  |
| Wannsee | Wannsee-Lichtspiele
(Lage) |
Königstraße 49 | 1946–1968 |  |
| Zehlendorf | Bali
(Lage) |
Teltower Damm 33 | seit 1946 |  Das Bali befindet sich nahe des S-Bahnhofs Zehlendorf in einem eingeschossigen Flachbau (200 m² Grundfläche), hinter dem Haus Teltower Damm 33, in die Gartenstraße hinein. „BALI“ heißt eigentlich Bahnhofslichtspiele.[207] Das Bali wurde 1946 eröffnet und ist seither ohne Unterbrechung in Betrieb. Die kinotechnische Grundlage war eine Projektionsanlage, die russische Soldaten[208] in dem vormaligen Tanzsaal[209] zurückließen. Die Räumlichkeiten[210] im ehemals als Wintergarten genutzten Anbau des um 1900 errichteten „Burg Hotels“ wurden in den 1920er Jahren zur Tanzdiele ausgebaut.[207] Als Inhaber des Bali mit 200 Plätzen wird 1949 Robert Kayser aufgeführt. Das Kino bietet täglich zwei Vorstellungen, die Vorführausstattung besteht aus dem Projektor Erko IV und Klangfilm-Verstärker, sowie die Dia-Projektion. 1950 waren die Erben von Georg Schenk und Gertrud Gerkes die Besitzer, deren Geschäfte führte Käthe Schultz. Als Frau Charlotte Schenk 1953 die Inhaberin wurde, gab es neben dem Verstärker Klangfilm-Eurodyn und zum Ernon-Projektor auch eine Ernemann IX-Vorführmaschine. Es wurden 16 Vorstellungen je Woche gespielt. 1957 ist im Kino-Adressbuch die Breitwandausrüstung für CinemaScope genannt, die mit den beiden Projektoren (Lichtquelle: Reinkohle) in Einkanal-Lichtton und dem Format 1:2,35 möglich wurde. Die Dia-Projektion war mit Ton. Die ausgewiesenen 209 Plätze sind mit Flachpolster-Klappsitzen von Kamphöner ausgestattet. 1973 wurde das „bali-filmkunst“ mit der Übernahme vom Mitbegründer des Arsenal Manfred Salzgeber (cineart GmbH, Post: Berlin 33 Cunostraße 65) in den 1970er Jahren das führende politische Kino in Deutschland.[Anm 14] Als das Programm des Kinos im Laufe der Jahre immer anspruchsloser wurde, verließ Manfred Salzgeber das 'Bali' im Januar 1978, begleitet von lauten Protesten. Seit 1978 betreibt „die filmverrückte Besitzerin Helgard Gammert“[211] das Kino (14163 Berlin, Busseallee 35).[Anm 15] Das Bali hatte seit den 1980er Jahren noch 142 Plätze. Die gegenwärtige Ausstattung beläuft sich auf 128 Sitzplätze. Die Projektion erfolgt sowohl mit 35mm analog als auch in Digital 4K. Der Ton wird in Dolby Digital 5.1 angeboten. Die Bildwand ist 5 m × 8 m groß.[207] Der Kinosaal besitzt, ähnlich wie ein Varieté, zwischen erster Reihe und Leinwand einen Tanzboden und eine kleine Bühne. Ein Piano kann bei diversen Veranstaltungen (auch Filmvorführungen) zum Einsatz kommen. Helgard Gammert betreibt das unter Salzgeber ins Leben gerufene Kinder- und Jugendprogramm weiter. So rief sie 1986 die Berliner „Kinder-Kino-Initiative“ ins Leben, bei der jeden Monat – unterstützt vom Hauptverband der deutschen Filmtheater – ein ausgewählter Kinderfilm durch 20 Berliner Kinos tourte. Das Kino erhielt für Jahresfilmprogramme verschiedene Auszeichnungen: vom Bundesministerium des Innern, dem Bundesministerium für Angelegenheiten der Kultur und Medien und dem Filmboard Berlin-Brandenburg. Persönlich erhielt Frau Gammert 2005 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Neben dem täglichen Filmprogramm gibt es im Haus Ausstellungen, Tanznächte, Dichterlesungen, Vorträge und Theaterveranstaltungen. Die das Bali bedrohende Planung eines neuen Kulturzentrums im 'Primuspalast' an der Gartenstraße wurde wegen eines fehlenden Investors vorerst fallengelassen. Das leerstehende Geschäft neben dem 'Bali' wurde zum „Café Oscars“ umgebaut und soll als Veranstaltungsort für Sonderveranstaltungen und als Foyer für das Kino genutzt werden. Bilder vom Projektionsraum und aus dem Jahr 2007 finden sich in diesen Internetquellen:[212][213] |
| Zehlendorf | Elfi-Lichtspiele
(Lage) |
Teltower Damm 216 | 1952–1969 |  |
| Zehlendorf | Onkel-Tom-Kino
(Lage) |
Wilskistraße 47b | 1934–1968 |   |
| Zehlendorf | Panorama
(Lage) |
Sundgauer Straße 83 | 1954–1977 | Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. |
| Zehlendorf | Primus-Palast
(Lage) |
Berliner Straße 8 | 1949–1969 |  |
| Zehlendorf | Rathaus Lichtspiele
(Lage) |
Teltower Damm 18 | 1943–1958 |  |
| Zehlendorf | Zeli ---- Zehlendorfer Lichtspiele (Lage) |
Potsdamer Straße 50a | 1918–1972 | Die Wikipedia wünscht sich an dieser Stelle ein Bild vom hier behandelten Ort. Weitere Infos zum Motiv findest du vielleicht auf der Diskussionsseite. Falls du dabei helfen möchtest, erklärt die Anleitung, wie das geht. |
| Zehlendorf | Zinnowwald-Lichtspiele | Wilskistraße 80 | 1947–1958 |  |
Schließen
Remove ads
Literatur
- Sylvaine Hänsel, Angelika Schmitt (Hrsg.): Kinoarchitektur in Berlin 1895–1995. Verlag Reimer, Berlin 1995, 296 Seiten, ISBN 3-496-01129-7.
- Reichs-Kino-Adressbuch. Berlin, LBB 1918–1942. (Standortlisten)
- Matthias Gibtner: Herausforderungen und Tendenzen im deutschen Kinomarkt unter besonderer Berücksichtigung der Berliner Situation. Diplomarbeit, 2006. Dazu: Online in der Google-Buchsuche
Weblinks
- filmtheater.square7.ch: unter dieser Adresse sind die Angaben des Kinowiki gehostet. Dessen Angaben wurden vorzugsweise aus Spezialadressbüchern: Reichskino Adressbuch (Verlag Lichtbühne) und Kinoadressbuch (Verlag Max Mattisson) und der regelmäßig in der Ersten Fachzeitschrift für die gesamte Lichtbild-Kunst, Der Kinematograph, veröffentlichten Kinoliste (1907–1910) zusammengetragen. Näheres: (zu) Film- und Kino-Adressbuch und Der Kinematograph.
- Kinos auf KinoWiki
- allekinos.com/berlin Sammlung alle Kinos: Stichworte Steglitz und Zehlendorf
- Berlins unabhängiger Kinoführer: Erlebnisberichte aus bestehenden Kinos
- luise-berlin.de: Kinos auf der Spur – Alle Kinos im Computer
- berlin-magazin.info: Berlin-Kinos
- Jeanpaul Goergen: filmportal.de: Film und Kino in Steglitz. Eine filmhistorische Chronik
- Aktuelle Meldungen auf kinokompendium.de
Remove ads
Einzelnachweise
Anmerkungen
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads